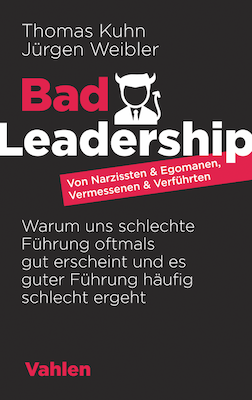„Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung tut, was zu tun befohlen wird …“
 Schlechte Führung, sofern sie sich langfristig an der Macht behauptet, ist in der Regel Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels dreier Faktoren: einer problematischen Persönlichkeit der führenden Person – empirisch betrachtet meist männlich –, einer begünstigenden Kontextsituation und, in weit höherem Maße als gemeinhin angenommen, der Unterstützung durch Geführte (Kuhn/Weibler 2020). Mit anderen Worten: Bad Leadership verweist fast immer auch auf Bad Followership.
Schlechte Führung, sofern sie sich langfristig an der Macht behauptet, ist in der Regel Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels dreier Faktoren: einer problematischen Persönlichkeit der führenden Person – empirisch betrachtet meist männlich –, einer begünstigenden Kontextsituation und, in weit höherem Maße als gemeinhin angenommen, der Unterstützung durch Geführte (Kuhn/Weibler 2020). Mit anderen Worten: Bad Leadership verweist fast immer auch auf Bad Followership.
Die Geführten sind demnach nicht ausschließlich als Opfer schlechter Führung zu begreifen. Vielmehr sind sie – in Anlehnung an Stephen Greenblatt – häufig als Mitverantwortliche oder gar Ermöglicher:innen des Entstehens und Fortbestehens dysfunktionaler Führung zu verstehen. Diese Perspektive mag zunächst paradox erscheinen: Warum sollten Menschen eine Führung dulden oder gar aktiv fördern, von der sie selbst geschädigt werden – sei es durch feindseliges Verhalten, Missachtung ihrer Anliegen oder strukturelle Ungerechtigkeit? Und doch scheint genau dies nicht selten der Fall zu sein. Dabei sollten wir in perspektivischer Erweiterung schon einmal im Kopf behalten, dass eine Duldung oder Förderung leichter nachvollziehbarer wird, sofern man selbst von den Handlungen des Führenden nicht betroffen ist und sogar davon profitiert.
Was also „bewegt“ Geführte dazu, destruktive Führung zu tolerieren, zu akzeptieren oder gar zu befördern? Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden – mit dem Fokus auf jene Gefolgschaft, die sich ohne existenzielle Bedrohung von einer schlechten Führung distanzieren könnte. Menschen, die sich in Ausnahme- oder Extremsituationen befinden, erfordern differenzierte ethische und juristische Betrachtungen, weshalb sie in dieser Analyse bewusst ausgeklammert werden – ohne jedoch die Möglichkeit auszuschließen, dass auch dort vergleichbare Mechanismen wirksam sind.
Schlechte Führung aus Perspektive der Geführten
Ein Forscherteam um den US-amerikanischen Psychologen Christian Thoroughgood bezeichnet jene Personen als verlorene Seelen, die sich insbesondere von charismatisch-destruktiven Führungspersönlichkeiten angezogen fühlen – in der Hoffnung, von diesen Orientierung, Zugehörigkeit, Selbstwert und emotionale Sicherheit zu erhalten.
Diese Dynamik greift die Politikwissenschaftlerin Jean Lipman-Blumen in ihrem Werk „Die Verlockungen der toxischen Führenden“ auf. Im Untertitel stellt sie die zentrale Frage: „Warum folgen wir zerstörerischen Chefs und korrupten Politikern?“
Ausgehend von der These einer weiten Verbreitung toxischer Führung in Politik und Wirtschaft analysiert sie deren Attraktivität aus tiefenpsychologischer Perspektive und identifiziert insbesondere folgende Erklärungsansätze:
- Autoritätsbedürfnisse
Frühkindlich verankerte Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit, Anerkennung und Orientierung führen – zumeist unbewusst – zu einer Übertragung früher Autoritätsvorstellungen auf gegenwärtige Führungspersonen. Der Psychoanalytiker und Führungsexperte Manfred Kets de Vries spricht in diesem Zusammenhang von transference: einem psychodynamischen Prozess, in dem Führenden eine Allwissenheit und Stärke zugeschrieben wird, die ursprünglich Eltern oder Lehrer:innen zugedacht war. Dies kann zu einer kritiklosen Gefolgschaft führen, selbst dann, wenn die Geführten ausgenutzt oder manipuliert werden. - Existenzielle Ängste
Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit – ohne Kenntnis von Zeitpunkt oder Art des Todes – erzeugt ein tiefes Bedürfnis nach Sinn und Dauerhaftigkeit. Toxische Führende bedienen diesen Wunsch, indem sie den Geführten das Gefühl vermitteln, Teil von etwas Größerem, gar Auserwähltem zu sein – mit dem impliziten Versprechen von Unsterblichkeit, sei es symbolisch oder spirituell. - Situative Ängste
In einer zunehmend als komplex, volatil und unsicher empfundenen Welt (z. B. durch Globalisierung, technologische Disruption) wächst das Bedürfnis nach Ordnung, Klarheit und Stabilität. Wer sich als Führender glaubhaft als Garant:in für „Ruhe und Ordnung“ inszeniert, gewinnt leichter Zustimmung – auch wenn dies mit autoritären oder repressiven Mitteln geschieht. - Versagensängste
Die hohe Leistungsorientierung in modernen Marktgesellschaften verstärkt individuelle Ängste vor persönlichem, sozialem oder beruflichem Scheitern. Destruktive Führende inszenieren sich häufig als souveräne Siegergestalten, denen es gelingt, in allen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Für Menschen mit geringem Selbstwert oder chronischem Vergleichsdruck kann dies hochgradig attraktiv wirken – und das Gefühl erzeugen, sich durch Nähe zur Macht selbst aufzuwerten.
Gehorsam, Opportunismus und das Spektrum des Bad Followership
Neben psychodynamischen Erklärungen ist auch das Konzept des Gehorsams gegenüber Autoritäten ein zentrales Element der Diskussion um destruktive Gefolgschaft. Die Harvard-Professorin Barbara Kellerman unterscheidet in ihrer auf die NS-Zeit bezogenen Typologie drei Formen des Bad Followership:
- Zuschauende („Bystanders“) – distanzieren sich nicht, weil sie die Ideologie akzeptieren oder den Preis des Widerstands fürchten.
- Ausführende („Evildoers“) – handeln aus Gehorsam gegenüber Anweisungen.
- Überzeugte („Acolytes“) – identifizieren sich, beseelt vom Bösen, aktiv mit der destruktiven (bis hin zu völkermordenden) Ideologie.
Christian Thoroughgood ergänzt dies um einen weiteren Typus, der in aktuellen Kontexten besonders relevant ist: den Opportunisten. Diese Personen unterstützen schlechte Führung nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül – in der Erwartung persönlicher Vorteile. Derartige Akteure verkörpern im Übrigen das Idealbild des Homo oeconomicus, der moralische Erwägungen systematisch ausblendet, um strategisch eigene Interessen durchzusetzen – auch auf Kosten anderer. Dass ein solch kalkulatives Verhalten in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium befördert wird, sei am Rande bemerkt (Petersen/Keller/Weibler Hariskos 2019).
Schlechte Führung als kulturelles und historisches Phänomen
Schlechte Führung ist kein neues Phänomen. Ihre vielfältigen Erscheinungsformen sind (kultur)historisch dokumentiert und literarisch intensiv reflektiert worden – nicht selten mit einer gewissen Faszination. Ihre Bewertung ist jedoch auch abhängig von sich wandelnden moralischen Normen. So lässt sich etwa die politische Lehre Niccolò Machiavellis (1469-1527) je nach ethischem Standpunkt als klug oder zynisch interpretieren.
Der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt widmete sich in Der Tyrann (2018) erhellend der Frage, wie es möglich ist, dass ganze Gesellschaften tyrannischer Führung zum Opfer fallen. Anhand von Shakespeares Richard III zeigt er auf, dass nicht nur der Führende, sondern auch die vielfältig versagende Reaktion der Geführten den Aufstieg des Tyrannen ermöglicht:
- Einige werden durch Gewaltandrohung eingeschüchtert.
- Andere hoffen auf persönlichen Nutzen und leisten Beihilfe.
- Wieder andere erkennen das Böse nicht oder ignorieren es bewusst – bis es zu spät ist.
Bemerkenswert dabei ist, dass Shakespeare diese Mechanismen bereits 1592 beschrieb – ein eindrucksvoller Beleg für die historische Konstanz bestimmter Dynamiken im Verhältnis von Führung und Gefolgschaft.
Fazit: Schlechte Führung reflektieren, gute Führung stärken
Schlechte Führung wird es auch künftig geben – doch ihre Existenz darf uns nicht dazu verleiten, sie als gegeben hinzunehmen. Gerade weil wir heute über ein breiteres Repertoire an wissenschaftlichen Erkenntnissen verfügen, sollten wir uns der Dark Side of Followership bewusst werden – und zugleich konstruktive Impulse setzen, wie gute, integre und wirksame Führung gestärkt werden kann. Es bleibt eine gemeinsame Aufgabe – für Führende ebenso wie für Geführte.
Anmerkung: Dieser Text ist eine aktualisierte Fassung einer längeren Passage aus Kuhn/Weibler 2020.