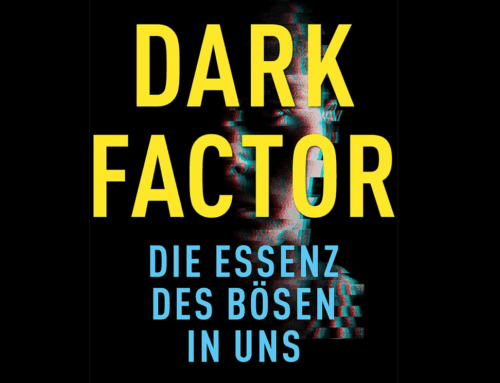Prof. Dr. Wendelin Küpers
Interview mit Prof. Dr. Wendelin Küpers von der Budapesti Corvinus Egyetem / Corvinus University of Budapest, Institute of Strategy and Management, Department of Organizational Behaviour and Human Resource Development.
Prof. Küpers, New Work wird breit diskutiert. Wie aber kamen Sie zum Thema „Workation“ und „Holiwork“? Sind dies für Sie neuere Formen, seine Arbeit in Unternehmen zu gestalten?
Seit längerem beschäftige ich mich mit Fragen der Bedeutung der Arbeit, insbesondere auch in Beziehung zum Leben und zu Fragen des Sinns. Auch verfolge ich seit längerem die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik der sogenannten ‚Neuen Arbeit‘ und beobachte entsprechend neue Arbeits- und Existenzformen. New Work zielt ja darauf ab, Menschen zu ermöglichen, zumindest zeitweise etwas zu tun, wofür sie eine Leidenschaft haben und woran sie tief glauben sowie eine Selbstentfaltung erleben. Ich erinnere mich an einer Begegnung mit dem Vordenker der neuen Arbeit Frithjof Bergmann, der das Bedürfnis nach neuer Arbeit in die Leitfrage formulierte „Was will ich wirklich, wirklich tun?“
Zudem, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, lässt sich das sehr gut mit einem anderen Forschungsstrang verbinden, dem von Leiblichkeit und Emotionen. Neue Technologien verbinden diese Bereiche in der Praxis, z. B. ermöglicht die Digitalisierung eine Entkopplung von Arbeit und Aufenthaltsort. Seit der Pandemie und dem damit verbundenem Homeoffice und neue Formen der sog. Remote Work wächst das Interesse und die Bedeutung an all diesem, aber damit gehen auch spezifische Herausforderungen für alle Beteiligten ein.
Gehen wir klassisch vor. Kommen wir zur Bedeutung der Begriffe, die nicht gerade gängig im Vokabular des Managements sind.
Nun, beide Begriffe sind im Bereich des Work-Life-Blendings zu verorten. Es sind Wortverbindungen von „Work“ und „Vacation“ sowie „Holidays“ und „Work“. Es geht um die räumliche Trennung zwischen der eigentlichen Arbeitsstätte und der Lokation, von wo Arbeit geleistet wird. Spezifisch geht es bei der Holiwork um eine zeitlich begrenzte, digital vermittelte Art und Weise im Ausland zu arbeiten. Wie wir noch sehen werden, geht es aber um mehr als die Arbeitsform allein. Diese Form der Arbeit berührt existenzielle Erwartungen und muss deshalb in einem engen Bezug zur Lebensform gesehen werden. Bitte beachten Sie dabei, dass damit nicht das freiberufliche digitale Nomadentum angesprochen ist, das bereits eingehend untersucht wurde. Bei dem hier gemeinten Arbeitsverhältnis bleibt der Mitarbeiter weiterhin beim Unternehmen angestellt und wird sogar von einem Coach begleitet.
Man könnte ketzerisch fragen, warum sich Unternehmen mit dieser etwas exotisch anmutenden neuen Form der Arbeit überhaupt beschäftigen müssen. Anders formuliert: Warum ist das für die Praxis, zumindest einem Teil davon, bedeutsam?
Nun, das hat uns auch umgetrieben und wir sind dem nachgegangen. Unsere Resultate haben wir in zwei Studien aktuell veröffentlicht. Beide Studien deuten auf einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitskultur hin. Arbeit wird wie erwähnt räumlich entgrenzt, digital vermittelt und existenziell neu verortet. Es gibt entsprechend einen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern für solche Arbeits- und Lebensformen. Andererseits sind es gerade jüngere Menschen, die solche neuen Arrangements des Arbeitens und Lebens nachfragen.
Organisationen und Führung müssen sich diesen Herausforderungen stellen und sich fragen, wie sie ortsflexibel und dennoch beziehungsorientiert wie auch sinnvermittelnd solche Mobilitäten ermöglichen. Und dies, ohne die Verbindung zu den Protagonisten zu verlieren sowie selbst Verantwortung auszuüben und Verantwortlichkeit einzufordern. Anders formuliert: Wie kam das Bedürfnis nach Entfaltung beim einzelnen Mitarbeiter, hier zeitweise ins Ausland gehen zu können, entsprochen und zugleich eine Zugehörigkeit zum Unternehmen gefestigt werden?
Das wird viele Vorgesetzte und die Unternehmensleitung bewegen. Kommen wir also zu ihren beiden Studien und natürlich den Befunden.
Es gab wie gesagt zwei Studien, in denen wir uns mit dieser Thematik beschäftigten: Zum einen eine quantitative Studie mit dem Titel: „Workation as an Attractive Work Arrangement“ (2025) in der wir uns mit der Attraktivität diese neuen Lebensformen unter die Lupe nahmen. Basierend auf zwei experimentellen Studien mit 351 Teilnehmenden wurde gezeigt, dass Stellenausschreibungen mit „Workation“-Option als deutlich attraktiver wahrgenommen werden als solche ohne Remote- oder Reiseoptionen. Besonders Personen mit internationaler Erfahrung und positiver Haltung zu Auslandserlebnissen bewerten solche Angebote höher.
Die sog. „Workation“ wird von Mitarbeitern als „innovative Zusatzleistung“ wahrgenommen, die Autonomie, Zufriedenheit und Erlebnisqualität steigert. Unsere experimentellen Daten zeigen, dass die Attraktivität von Stellenanzeigen mit Workation-Option um durchschnittlich 18% höher bewertet wird – mit besonders starken Effekten bei Kandidaten mit Auslandserfahrung. Die Attraktivität ist besonders groß für jüngere Generationen (Millennials, Gen Z), die Arbeit, Reisen und Sinnsuche verbinden wollen. Workation ähnelt in mancher Hinsicht dem erwähnten digitalen Nomadentum, unterscheidet sich aber durch die formale Einbindung ins Unternehmen und eine zeitlich begrenzte Mobilität.
Zum anderen haben wir in einer zweiten empirischen Studie mit dem Titel : „Holiworking: Perspectives on New Ways of Integrating Holiday and Work“ (2025) speziell das sogenannte Holiwork als eine neue hybride Arbeitsform untersucht. Arbeit und Urlaub werden ja wie gesagt dabei an einem temporären Auslandsort kombiniert. Die methodische Basis dieser Forschungsarbeit war die Grounded-Theory, gegründet in konkreten Erfahrungen der Holiworker, die zwischen 2 Wochen und 6 Monaten im Ausland arbeiteten. Damit gingen wir tiefer auf die vielschichtigen Erlebnisdimensionen von diesen Mitarbeitern ein. Insbesondere wurden sie befragt, wie sie eine solche temporäre Mobilität und Tätigkeit im Ausland an sich und im Verhältnis zum Unternehmen, also mit einer bleibenden organisationaler Bindung, erleben.
Letztendlich und das war doch überraschend, kristallisierten sich drei fundamentale Ambivalenzen heraus: (1) die paradoxe Produktivität zwischen beruflicher Verpflichtung und Freiheitserfahrung, (2) die existenzielle Verwurzelung zwischen Sesshaftigkeit und nomadischer Mobilität sowie (3) die Spannung in der Verbundenheit zwischen digitaler und körperlicher Ko-Präsenz (Nähe) und digitaler Telepräsenz (Distanz). Diese Spannungen sind nicht auflösbar, sondern müssen kontinuierlich ausbalanciert werden.“
Darauf sollten wir detaillierter eingehen.
Die sog. Holiworker erleben sowohl Freiheit und Erfüllung durch kulturelle Entdeckung als auch Stress, Fragmentierung und Einsamkeit. Sie müssen aktiv Strategien zur Abgrenzung von Arbeits- und Freizeiten entwickeln – zeitlich durch bewusste Rituale des Übergangs, räumlich durch dedizierte Arbeitszonen auch an Urlaubsorten, kommunikativ durch explizite Verfügbarkeitsregeln, und leiblich durch achtsame Körperpraktiken wie Bewegung und Meditation, die den Wechsel zwischen den Modi markieren.
Diese Form des Arbeitens wird insbesondere von jüngeren, mobilen Wissensarbeiter gewählt, die Stabilität (fester Job, Einkommen) mit Weltoffenheit und Selbstverwirklichung verbinden wollen. Das möchte und kann auch nicht jeder. Damit birgt Holiwork gleichzeitig Risiken wie z. B. die Entstehung neuer sozialer Ungleichheiten zwischen remote-fähigen und nicht-remote-fähigen Beschäftigten.
Was folgt daraus für Führungskräfte und die Organisation?
Beide Studien deuten auf einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitskultur hin: Arbeit entgrenzt sich von klassischer räumlicher Verortung und durch neue digitale Vermittlungsmöglichkeiten ergeben sich neue existenzielle Bestimmungen des Verhältnisses von Arbeit und Nichtarbeit. Führung, die mit diesen ortflexiblen, beziehungsorientierten und sinnbezogenen Bezügen umgehen will, muss sich entsprechend vom Kontroll- zum Vertrauens- und Resonanzmodell entwickeln. Resonanz bedeutet hier nicht nur digitale Erreichbarkeit, sondern die Qualität wechselseitiger Responsivität. Forschungsstudien, davon einige auch von mir, haben dies seit längerer Zeit untersucht [z. B. Küpers 2021] . Organisationen müssen lernen, genuine Interessen von Mitarbeitern hinsichtlich Arbeit und Leben mobiler zu organisieren und zugleich den Bezug zu den Kollegen und zum Unternehmen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch eine gelingende Reintegration nach dem Auslandsaufenthalt. So entsteht ein neues Leitbild von Organisationen, die globale bzw. ‚glokale‘ also globale und zugleich sich immer neue lokalisierende Mobilität ihrer Mitarbeiter ermöglichen, ohne Verbindung und Verantwortung zu verlieren.
Bezüglich der ersten Studie gibt es folgende spezifische Implikationen für Organisationen und Führung. Unternehmen, die Workation anbieten i. S. eines Employer Branding, steigern ihre Anziehungskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Kampf um Talente. Dieses Talent Management ist besonders relevant zur Gewinnung und Bindung von jungen, mobilen Fachkräften mit internationaler Orientierung. Führungspersonen müssen lernen, Vertrauen, Selbstorganisation und Ergebnisorientierung stärker zu betonen statt Präsenzkontrolle. Dazu brauchen Organisation neue Formen und Praktiken von Führung. Workation erfordert interkulturelle Sensibilität und Unterstützung bei Integration, Kommunikation und Rückkehr, also kulturelle Kompetenz und kulturelle Intelligenz.
Da Arbeit und Freizeit in enger Beziehung stehen, sollten Organisationen Praktiken der Achtsamkeit, Reflexion und Grenzziehung fördern, i. S. eines Wellbeing Managements. Ich nenne dies übrigens Well-becoming, denn das Wohlergehen ist kein statischer oder ‚erreichbar‘ fester Zustand, sondern ein andauernder, sich anpassender Werdensprozess. Dies umfasst nicht nur mentale Gesundheit, sondern auch die leibliche Selbstsorge – die Fähigkeit, auf körperliche Signale von Überlastung zu achten und zwischen intensiver Arbeit und regenerativer Erholung zu alternieren.
Unternehmen müssen zudem rechtliche, versicherungstechnische und steuerliche Rahmenbedingungen und Regulationen klären – etwa Fragen der Sozialversicherungspflicht bei längerem Auslandsaufenthalt, der Arbeitszeiterfassung über Zeitzonen hinweg, des Datenschutzes bei internationaler Datenübertragung, sowie der steuerlichen Betriebsstättenproblematik. Diese praktischen Hürden werden in der Forschung als größte Implementierungsbarrieren genannt, wobei Großunternehmen hier Vorteile haben. Daraus ergibt sich zwar kein prinzipielles, aber tatsächliches Gefälle zwischen Großunternehmen und KMUs. Für Letztere ist das bei kleineren Zahlen aufwändiger anzugehen.
Auch die zweite Studie hat ähnliche Implikationen. Organisationen müssen hybride Mobilitätsmodelle entwickeln, die gesundheitliche Aspekte klären und zugleich soziale Kohäsion fördern. Führung auf Distanz, wie sie im Holiwork notwendig wird, verlangt neue Formen der responsiven Kommunikation, Vertrauen und digitaler Telepräsenz. Führungskräfte sollten Ambiguitätstoleranz fördern, wie auch Räume für Selbstorganisation und lokale Einbindung schaffen, und auf Work–Life-Integration statt Trennung setzen. Entsprechend müssen auch die Personalpolitik und Unternehmenskultur auf die Integration von Arbeit, Freizeit und globaler Mobilität ausgerichtet werden. Integrales Denken ist also zu fordern und eine integrative Praxis zu fördern. Aber vergessen wir nicht: Ein einziges mehr an Bord geholte Talent kann bereits den Unterschied zwischen Wettbewerbern ausmachen. So könnten sich die Anstrengungen doppelt auszahlen.
Insgesamt zeigt unsere Studie zu Holiwork die Evolution einer digital-relationalen Arbeitskultur, in der Technologie Mobilität unterstützt, ohne jedoch soziale Verbundenheit zu ersetzen.
Zugleich werden neue Fairness- und Inklusionsfragen gestellt. Organisationen müssen sicherstellen, dass flexible Modelle nicht zu neuer beruflicher Spaltung führen – etwa zwischen hochqualifizierten Wissensarbeitern mit Mobilitätsprivilegien und standortgebundenen Beschäftigten in Produktion oder Dienstleistung. Workation bzw. Holiwork darf nicht zum Statusmarker einer neuen mobile Arbeitselite werden. Dies erfordert transparente Zugangskriterien und gegebenenfalls kompensatorische Maßnahmen.
Was wäre Ihre abschließende Einschätzung zur Entwicklung dieser neuen Arbeitsformen?
Beide Formen des Tätigseins, Holiwork und Workation, markieren einen Paradigmenwechsel hin zu Arbeitsformen, bei denen die Rolle des Raumes, der digitalen Technologien und Beziehungsgefüge in und mit den Unternehmen sich neu konfigurieren. Organisationen werden damit zu mobilen Beziehungsräumen, in denen Zugehörigkeit, Sinn und Selbstentwicklung neu zu gestalten ist.
Da technologische Innovationen (AI-basierte Kollaboration, immersive Kommunikation, metaverse-basierte Telepräsenz) diese Entwicklung künftig beschleunigen, wird die Fähigkeit, digitale Mobilität und soziale Einbettung zu balancieren, zu einer zentralen Führungs- und Kulturkompetenz.
Ich glaube nicht, dass virtuelle Ko-Präsenz die leibliche Kopräsenz ersetzen wird, sondern diese ergänzen wird. Nach unseren Befunden bleibt die direkte leiblich-sinnliche Begegnung zentral für Vertrauensaufbau und soziale Integration sowie Sinnerfahrung – virtuelle Formate können zeitweise substituieren, aber nicht vollständig kompensieren.
Mit einem perspektivischen Ausblick können wir davon ausgehen, dass neue Arrangements von Arbeit und Leben in Zukunft noch stärker von digitaler Infrastruktur, KI-Assistenz, VR-Interaktion und ortsunabhängiger Kollaboration geprägt sein werden. Holiwork und Workation sind damit in gewisser Weise Vorläuferformen einer breiteren Bewegung hin zu technologisch unterstützten Beziehungen, die Teil und Ausdruck von fluideren Arbeits- und Lebensbiografien sind. Für Organisationen und deren Führung bedeutet dies, ermöglichende Angebote und Plattformen, leitende Regeln und offene Unternehmenskulturen zu entwickeln, die Freiheit, Beziehungen, aber auch ganzheitlichen Sinn und betriebliche Zweckmäßigkeiten in einen befriedigenden Zusammenhang zu bringen vermögen.
Zum Schluss. Ich glaube, dass diese neuen Arbeitsfomren mehr sind als eine Modeerscheinung, sondern Symptom und Versprechen zugleich. Sie sind Ausdruck einer Gesellschaft und einer Sehnsucht von Menschen, Sinn in anderen Konstellationen des Arbeit- und Lebenszusammenhangs zu finden oder neuerfinden zu wollen. Aber die Herausforderung wird sein, dass diese neuen Formen strukturelle Einbettung in die Organisationen und eine darauf eingehende Unternehmensführung benötigen. Vor allem braucht es aber auch der Kultivierung leiblicher Achtsamkeit und Bestimmung von Grenzen zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit wie auch Fairness und Inklusion, damit nicht eine neue Elite von wenigen Sinnarbeitern entsteht, die dies exklusiv erleben können. Ich sehe damit große Potenziale für einen tiefgreifenden Wandel des Arbeits- und Lebenszusammenhangs.
Prof. Küpers, danke sehr für das inspirierende Gespräch.
Das Interview führte Prof. Weibler (Leadership Insiders).