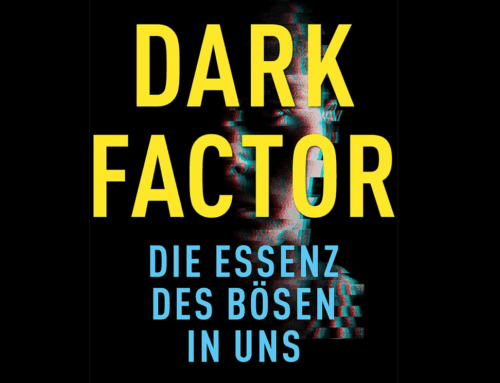Leadership bedeutet im Kern verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. Vieles wurde hierbei in letzter Zeit richtig gemacht, eines jedoch vergessen: Wir brauchen wieder mehr Zukunftseuphorie! Führungspersonen in Unternehmen, Institutionen oder Politik sind meist sehr geschult darin, schlaue Pläne zu entwickeln und zu verbreiten. Doch hierbei gibt es einen blinden Fleck. Was so gut wie immer fehlt, ist eine authentische, affektive Verbindung mit diesen schlauen Plänen – auf Seiten der Urheber wie auch auf Seiten der Rezipienten.
Leadership bedeutet im Kern verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. Vieles wurde hierbei in letzter Zeit richtig gemacht, eines jedoch vergessen: Wir brauchen wieder mehr Zukunftseuphorie! Führungspersonen in Unternehmen, Institutionen oder Politik sind meist sehr geschult darin, schlaue Pläne zu entwickeln und zu verbreiten. Doch hierbei gibt es einen blinden Fleck. Was so gut wie immer fehlt, ist eine authentische, affektive Verbindung mit diesen schlauen Plänen – auf Seiten der Urheber wie auch auf Seiten der Rezipienten.
In anderen Worten: Wir brauchen nicht allein bessere Zukunftsbilder, sondern zusätzlich eine stärkere emotionale Verbindung mit diesen Bildern. Diese Verbindung wäre das Resultat eines radikalen Perspektivwechsels. Um Zukunftseuphorie als Katalysator für Leadership nutzbar zu machen, müssten die dominanten regressiven Anpassungsnarrative zurückgedrängt werden, die überall zu finden sind (Staab 2022). Sich auf die Zukunft einzustellen, bedeutet gerade nicht, sich alternativlos anzupassen. Stattdessen brauchen wir wieder mehr progressive Aufbruchsnarrative.
Dieser Gastbeitrag versteht sich daher als Gegengewicht zu den allgegenwärtigen resignativen Hiobsbotschaften, die unsere Welt zunehmend als einen trostlosen Ort erscheinen lassen. Er ist ein Plädoyer dafür, mehr Zukunftseuphorie zu wagen!
Zukunftseuphorie als Grundlage für Veränderungen
Zukunftseuphorie hilft, Vertrauen in gehaltvolle Ziele aufzubauen. Bekanntlich bestimmt die Qualität unserer Ziele auch die Qualität der Zukunft. An dieser Stelle greifen politische oder ökonomische Manifeste zu kurz, weil sie die Notwendigkeit und Kraft einer glaubwürdigen kollektiven Aufbruchstimmung unterschlagen oder vergessen haben.
Denn die Transformation von Gesellschaft, Unternehmen oder auch unserem eigenen Leben braucht motivierende Wunschbilder. Diese sollten mehr sein, als lediglich Zufallsprodukte. In der hektischen Betriebsamkeit des Alltags stellt sich allerdings eine Frage: Ist es möglicherweise attraktiver, Zukunftsvorstellungen zu konsumieren, anstatt Zukunft selbst absichtsvoll zu transformieren? Woran wir uns schleichend gewöhnt haben, sind lediglich Schrumpfformen des Wandels, die sich dadurch auszeichnen, dass wir zwar viel wissen, aber wenig fühlen. Was fehlt, ist die Wiederbelebung von Zukunftserzählungen mit positiven Emotionen. Wir brauchen endlich wieder Narrative, die ein euphorisches Gefühl für Zukunft erzeugen! Viel Zeit bleibt dafür nicht.
Zukunft als Katastrophe
Leider ist unsere Welt gerade kein Erfolgsmodell, sondern wir eher als Katastrophe wahrgenommen (Horn 2014). Wir stehen (metaphorisch gesprochen) dem Monster der Bodenlosigkeit gegenüber. Dieses haben wir selbst gezüchtet und ihm Namen wie Fortschritt oder Wachstum gegeben. Inzwischen bedroht es uns allerdings mit ökonomischer Konkurrenz, ökologischer Zerstörung sowie sozialer Desintegration.
Vor diesem Hintergrund ist die empirische Vermessung kollektiver Zukunftsvorstellungen junger Menschen (und damit auch kommender Führungskräfte!) besorgniserregend. Die Generation Z ist die frustrierteste Generation seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Optimismus wurde zum Auslaufmodell, das Grundrauschen der Gegenwart ist Resignation. Der Glaube an die die eigene Problemlösungskompetenz ging mittlerweile (im Durchschnitt) bei zwei Drittel der Teenager und jungen Erwachsenen verloren. Diejenigen also, die am meisten Zukunft vor sich haben, scheinen am wenigsten daran interessiert zu sein, diese auch mitzugestalten. Von eingebildeten Wohlstandsängsten (‚Reichweitenangst‘) bis hin zu manifesten geopolitischen Krisen findet sich darüber hinaus so gut wie alles im Warenkorb der Zukunftsängste. Das eigentliche Problem beginnt allerdings dort, wo wir zugelassen, dass Hoffnungslosigkeit zur gesellschaftlichen Standardeinstellung wird.
Zukunft als Praxis und Erzählung
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, braucht es ein angemessenes Verständnis von Zukunft. Zukunft ist mehr als eine chronologische Zeiteinheit, die Fortsetzung einer ‚Timeline‘ oder die Projektionsfläche für Trends. Zukunft ist eine lebenswichtige Ressource für Menschen, Unternehmen oder ganze Gesellschaften. Ständig geht es darum, „Zukunftsarmut“ in „Zukunftsreichtum“ zu verwandeln – meist nennen wir dies Hoffnung. Nur Menschen, die an ihre Zukunft glauben, entwickeln kreative Ideen und produktive Gestaltungsimpulse. Genau hier hilft Euphorie, denn sie verstärkt positive Zukunftsbilder und motiviert zum Handeln.
Zwar mangelt es nicht an Zukunftsentwürfen. Aber glauben wir eigentlich noch an unsere Zukunftserzählungen? Auf mutlose und angstbesetzte Anpassungserzählungen sollten wir zunehmend verzichten. Transformation muss mehr sein, als Überlebensdesign oder Reaktionen auf externen Druck. Euphorische Aufbruchserzählungen sind deshalb ein mächtiger Hebel für nachhaltige und langfristige Veränderungen. Vom Aufbruch zu erzählen, geht mit Sehnsucht, Neugier, Motivation und Empathie einher. Das ist kein Zufall, sondern zeigt, dass die Fähigkeit, Zukunft zu gestalten, Teil der menschlichen Kultur ist. Der Anthropologe Arjun Appadurai weist eindringlich darauf hin, dass es sich dabei um eine kollektive und kollaborative Aktivität handelt, die stets in soziale und kulturelle Kontexte eingebunden ist. Fast flehend erinnert er daran, dass die Zukunft nicht nur ein technischer oder neutraler Raum ist, sondern eine von Affekten und Empfindungen durchdrungene Praxis (Appadurai 2013).
Die Geschichte ist voll von Beispielen, die zeigen, wie großartige Aufbruchserzählungen Neues in Gang setzten, Menschen und Institutionen bewegten. Sie reichen von der Entdeckung neuer Kontinente bis zur Gründung utopischer Lebensgemeinschaften, neuer Staaten und überstaatlicher Verbünde wie den United Nations oder der European Space Agency. Euphorie war auch das Leitmotiv von Fortschrittsgeschichten, zum Beispiel während der Pionierzeit der Fliegerei oder im Space Age der 1960er-Jahre: Alles symbolisierte Zukunft, alles machte Lust auf Zukunft. Weltweit war ein neuer Atem zu spüren, eine Art Frühlingsgefühl der Menschheit. Es gab noch einen großen Vorrat an Hoffnung und eine unverbrauchte Aufbruchsstimmung (Selke 2022). Dies ist kein Plädoyer für einen nostalgischen Rückblick im Kontext einer „Retropia“ (Bauman 2017). Die Beispiele sollen lediglich daran erinnern, dass sich Zukunftshorizonte öffnen lassen. Kurz: Euphorische Zukunftsentwürfe wandeln Transformationsmüdigkeit in Transformationslust um. Genau das fehlt gegenwärtig so gut wie überall.
Zukunftseuphorie als Katalysator
Zukunft sollte dabei weder zu einer techno-utopischen Verheißung verkommen, noch ausschließlich Gegenstand rationaler und technokratischer Planungsprozesse werden. Vielmehr braucht es immer eine Beimischung des Utopischen. Das Ziel kann eigentlich nur in einem visionären Pragmatismus bestehen, der sich dadurch auszeichnet, dass Führungskräfte (oder Vordenker) fest auf dem Boden der empirischen Tatsachen stehen, gleichzeitig aber bereit und fähig dazu sind, Träume zum Leben zu erwecken.
Es könnte sein, dass dabei Überraschendes passiert. Denn Zukunftseuphorie fördert das Spiel mit produktiven Verunsicherungen, schafft Freude an Experimenten und aktiviert die Bereitschaft für Wandel. Ganz nebenbei wird auch das Belohnungssystem im eigenen Gehirn aktiviert. Deshalb ist Zukunftseuphorie wahrscheinlich der wirksamste ‚soziale Treibstoff‘ für Veränderungen. Plötzlich entsteht Begeisterung für schlaue Pläne, die vorher bestenfalls zur Kenntnis genommen wurden.
Einerseits kann Zukunftseuphorie als „Daseinsrausch“ erlebt werden, als Begeisterung über die Möglichkeiten des eigenen Zeitalters, über das Unternehmen, in dem man arbeitet, den Verein, in dem man sich engagiert, die Beziehung, die man lebt. Andererseits kann sich Zukunftseuphorie als „Schaffensrausch“ manifestieren, als Begeisterung für das, man (beruflich oder privat) tut, als inneres ‚Ja‘ zum äußeren Tun.
Zukunft als euphorisches Weltentwerfen
Um von der Standardeinstellung „transformation by desaster“ (Anpassung) zu „transformation by design“ (Aufbruch) (Sommer/Welzer 2014) zu gelangen, sollte das kognitive Zukunftsdenken um eine affektive Dimension ergänzt werden. Nicht Rechenleistung ist die Mangelware des 21. Jahrhunderts, sondern Zukunftseuphorie. Euphorische Menschen wollen aufbrechen. Dafür gibt es gute Gründe: Zukunftseuphorie ist ein Katalysator für Transformationen, weil das positive Gefühl die Wahrnehmung der Umwelt verändert und Zuversicht erzeugt. Derart wird es möglich, sich wieder als Teil der Welt zu sehen und den Wunsch zu entwickeln, aktiv in den Prozess des „Weltentwerfens“ (von Borries 2019) einzugreifen. Genau diese Einstellungen sind in zeitgenössischen Studien zu Zukunftsvorstellungen unterrepräsentiert.
Zukunftseuphorie kann als Platzhalter für eine Aufbruchsstimmung verstanden werden, die wie eine Flaschenpost an die kommende Generation funktioniert. Oder als Form symbolischen Kapitals jenseits des Ökonomischen, als Investition in kollektives Zukunftsvertrauen – als ‚utopisches Kapital‘. Jedenfalls ist Zukunftseuphorie eine vitale Ressource, die zur Revitalisierung von Transformationsprozesse nutzbar gemacht werden kann.
Mittlerweile sind viele gedanklich auf den Weltuntergang vorbereitet. Das ist traurig genug. Doch sind wir auch darauf vorbereitet, dass er nicht eintritt? Was passiert nach dem Ende der Krise? Jede Krise hat auch ein Danach. Für diese Zeit braucht es nicht nur schlaue Pläne, sondern auch ein Leitmotiv. Und das darf ruhig ein Hochgefühl sein: Zukunftseuphorie!