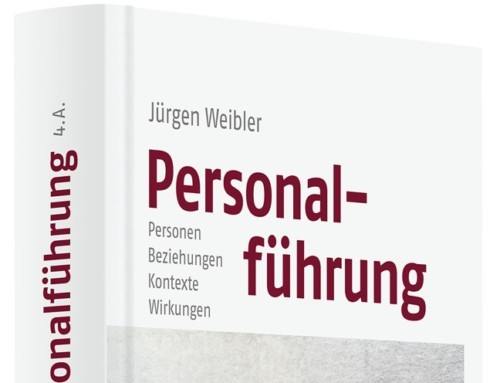ASDF_MEDIA
„No man is an island“ (John Donne 1624) – oder anders gesagt, jeder Mensch braucht (in der einen oder anderen Form) andere Menschen. Frühkindlich wird bereits grundgelegt, ob wir das soziale Miteinander gut meistern. Führung besteht zu einem großen Teil in der erfolgreichen Gestaltung sozialer Beziehungen, beispielsweise im Team. Was aber, wenn die sogenannten Bindungsorientierungen, die die sozialen Beziehungen anregen und ausgestalten, dafür suboptimal ausgeprägt sind? Leadership Insiders klärt auf und führt aus, wie man als Vorgesetzter mit Führungsanspruch dann schnell im Abseits steht und dadurch u.a. positive Emotionen nicht auslösen oder erwidern kann – allgemeines Führungsversagen infolge möglich.
Hintergrund
Evolutionär sind wir auf Schutz und Fürsorge angewiesen. Nähe zu anderen erhält uns am Leben, ihre Wertschätzung für uns bereichert es. Dies ist auch der Grund, warum neben anderen Abraham Maslow soziale Bedürfnisse als unverzichtbar zu erfüllende benannt und der Motivationsforscher David McClelland das Anschlussmotiv als eines der drei wesentlichsten ausgewiesen hat. Wie sich die Erfahrungen, die wir mit der Fürsorge durch andere in diesen frühen Jahren machen, auf unser gesamtes späteres Leben auswirken, suchte der britische Kinderpsychologe und Psychoanalytiker John Bowlby auf Grundlage von systematischen Beobachtungen herauszufinden (1969, 1973). Später arbeitete er dann übrigens an der renommierten Londoner Tavistock-Klinik.
Durch seine empirische Forschung erkannte er, dass frühe Trennung der Kinder und der Jugendlichen von ihren Bezugspersonen und emotionale Deprivation („Liebesentzug“) zu wesentlichen Veränderungen in den bindungsbezogenen Verhaltenssystemen führte. Spezifische affektive wie kognitive Erlebensweisen bildeten sich infolge zeitlich überdauernd aus. Folge dieser psychischen Vernachlässigung und des mangelhaften Erlebens von Fürsorge und Ansprechbarkeit durch eine Bindungsfigur in Zeiten empfundener Bedrohungen: ein unzureichendes Sicherheitsempfinden.
Wie Bowlby dann später auf Grundlage seiner Forschung in Einklang mit den Erkenntnissen seiner Mitarbeiterin Mary Ainsworth in seiner einflussreichen Bindungstheorie darlegte, kann sich eine sichere Bindung des Kindes nur dann herausbilden, wenn die Feinfühligkeit der primären Bindungsfigur den Bedürfnissen des Kindes Rechnung trägt. Nur dann, wenn die Bindungsfigur zuverlässig einen sicheren Hafen für das Kind bietet, und das Kind die Bindungsfigur grundsätzlich als sichere Basis begreift, wird das Kind dazu befähigt, autonom zu handeln. Ein Verweis zum Ur-Vertrauen nach Erik H. Erikson bietet sich an.
Was ist ein existenzielles Sicherheitsempfinden („Sichere Bindung“)?
Eine „Sichere Bindung“ zeichnet Ihre Persönlichkeit dann aus, wenn Sie sich in Zeiten von Unsicherheit und Bedrohung an andere wenden und Hilfe zulassen können, eine Tendenz haben, andere grundsätzlich einmal als vertrauenswürdig zu begreifen, aber gleichzeitig auch einen festen Glauben an die eigene Kompetenz und die Wirksamkeit Ihres Handelns vorweisen können.
Wie Sie sich und andere sehen, oder wie es genauer heißt, welche mentalen Repräsentationen des Selbst und der Anderen bei Ihnen vorliegen, prägen die Art und Weise Ihrer Bindungsfähigkeit wie Bindungsneigung zeitlebens. Diese gelten als schwer abänderlich und sind nach dieser Theorie nur durch einschneidende Erlebnisse mit signifikanten Anderen veränderbar (Beispiele für solche Ereignisse: Tod der Eltern, Scheidung).
Wenn wir also in Beziehungen eintreten, werden unsere entwicklungsgeschichtlich geprägten mentalen Repräsentationen automatisch aktiviert. Hier entsteht natürlich sofort die Frage: Wie kann man die Bindungsorientierungen, die vor allem zu Beginn als Bindungsstile (Attachment Styles) ausgewiesen werden, näher fassen?
Welche Ausprägungen haben Bindungsstile bzw. Bindungsorientierungen?
Eine erste Kategorisierung von Bindung prägte Mary Ainsworth zusammen mit ihren Kollegen (1978). Dort ließen sich im Wesentlichen drei Verhaltensmuster beobachten, die später weiter empirisch abgesichert wurden. Die drei darauf basierend abgrenzbaren Bindungsstile (Attachment Styles) definierte das Forschungsteam als
- ängstlich-ambivalente Bindung (1)
- vermeidende Bindung (2) und
- sichere Bindung (3).
Diese drei Stile führten sie auf inkonsistente (1), konsistent vernachlässigende (2) und angemessene Fürsorge (3) der Bindungspersonen zurück. Empirisch wurde nicht nur deutlich, dass diese Bindungskategorien auch bei Erwachsenen zu finden sind, sondern ebenso, dass beständig eine bestimmte Verteilung dieser Bindungsstile in der Gesamtbevölkerung nachgewiesen werden kann. So gelten zwischen 55-60% der Bevölkerung als sicher gebunden, während 20-25% eine vermeidende und immerhin ca. 15-20% eine ängstlich-ambivalente Bindung aufweisen (vgl. van Ijzendoorn 1995).
In späterer Forschung zeigte sich dann, dass man die unterschiedlichen Kategorien auf zwei Dimensionen verdichten kann: Bindungsangst und Bindungsvermeidung (vgl. Bartholomew/Horowitz 1991, Brennan et al. 1998). Jeder Mensch weist hier eine eigene Ausprägung auf beiden Dimensionen auf. Damit ist die individuelle Bindungsausprägung nun genauer bestimmbar – statt lediglich eine kategoriale Verortung vorzunehmen, wie früher üblich. Bindungsorientierungen lassen sich dabei wie folgt verstehen:
- Bindungsangst meint dabei das Ausmaß, in dem Individuen Angst vor Zurückweisung und eine übermäßige Abhängigkeit von Anderen zeigen. Das eigene Selbst wird als nicht liebenswürdig erfahren. Bindungsängstliche Individuen sind dabei übermäßig stark mit ihren Beziehungen beschäftigt, sehr emotional und zeigen eine übermäßige Sensibilität gegenüber Hinweisen auf eine mögliche Bedrohung sowie ein schlechtes Emotionsregulationsvermögen.
- Bindungsvermeidung hingegen beschreibt das Ausmaß, in dem Individuen sich übermäßig auf sich selbst verlassen und unabhängig von anderen sein möchten. Sie unterdrücken ihre (Bindungs-)bedürfnisse und Emotionen und werten die Bedeutung von interpersonalen Beziehungen ab. Andere werden als grundsätzlich wenig verlässlich angesehen. Bindungsvermeidende Individuen erleben ein Unbehagen mit Nähe und vermeiden somit enge Beziehungen.
Sind sowohl Bindungsangst als auch Bindungsvermeidung niedrig ausgeprägt, so liegt eine sichere Bindung vor.
Wie oben beschrieben, liegt damit ein positives Bild des Selbst und von Anderen vor. Andere werden grundsätzlich als vertrauenswürdig und verlässlich gesehen. Nähe und Autonomie können angemessen reguliert werden
Bedeutung der Bindung für die Führungskraft
Dass sowohl ein hohes Ausmaß der Bindungsangst wie auch Bindungsvermeidung bei Führungskräften negative Resultate hervorbringen, liegt auf der Hand, ist doch der Arbeitsplatz ein zutiefst sozialer, durch zwischenmenschliche Beziehungen geprägter Ort. Hier werden die ureigenst geprägten mentalen Modelle immer wieder aktiviert.
Hoch interessant und brandaktuell ist hier die bereits ältere Aussage von Cindy Hazan, Cornell University, und Phillip Shaver, State University of New York Buffalo, dass Personen, die Innovationen anstreben, eine gesunde Bindungserfahrung benötigen, um sich erfolgreich in unsicheren Situationen zurecht zu finden (1990). Gerade im Hinblick auf eine hohe Bindungsangst, die mit einer übermäßig hohen Empfindung von Stress in Zeiten der Unsicherheit einhergeht, ist intuitiv ersichtlich, welch schwerwiegenden Nachteil eine solche interpersonale Orientierung mit sich bringt. Solche Führungskräfte sind erst einmal mit ihren eigenen Emotionen und Bedürfnissen beschäftigt – allen voran ihrem mangelnden Glauben an die eigenen Fähigkeiten.
Wenn eine Führungskraft sich dann in ihrer Verunsicherung an andere wenden muss, um den Selbstwert zu stützten, statt mit angemessener Selbstwirksamkeit autonom Herausforderungen der Umwelt zu meistern, so wird sie in Zeiten der digitalen Transformation, die ihnen als Führungskraft viel abverlangen, kaum bestehen können (zu den Anforderungen siehe den Beitrag zur Singularität).
Ergo: Eine sichere Bindung muss vor einem Explorationsverhalten liegen, sonst wird Scheitern wahrscheinlicher; eine Führungskraft, die Teammitglieder als einen „sicheren Hafen“ ansehen, kann sie in unsicheren Zeiten ermutigen zu handeln, aber nur, wenn sie selbst eine sichere Bindung vorweisen kann.
Sicher gebundene Individuen haben entsprechend gegenüber den ängstlichen und den vermeidend Gebundenen signifikant geringere Einsamkeits- und Depressionsgefühle, sind weniger feindlich gesinnt, haben geringere psychosomatische Beschwerden und sind seltener krank. Sie fürchten, gerade für Innovationen wichtig, bei einem Misserfolg weniger eine persönliche Zurückweisung und fürchten sich allgemein weniger und können, das überrascht dann nicht mehr, sich besser entspannen.
Ein Forscherteam um Rivka Davidovitz von der Bar-Ilan University (2007), Israel, hat noch einmal sehr schön die positive Wirkung einer sicheren Bindung für die Führungsperson empirisch herausgearbeitet. Sehr interessant mit Blick auf den Führungserfolg war hier, dass die Geführten allein die Vorgesetzten, die eine sichere Bindung aufwiesen, als effektive Führungsperson einstuften, einmal in aufgabenorientierten, ein anderes Mal in emotionsgeladenen Situationen (Gruppenzusammenhalt, Energetisierung der Gruppe). Des Weiteren war die Motivation zu führen (Motivation to Lead) hier am höchsten ausgeprägt. Nur sicher gebundene Führende wurden als jemand angesehen, der positiv auf Stress bei den Geführten einwirkte und prosozial agierte.
Somit verhält sich ein Führender also mit einer durch Ängstlichkeit oder Vermeidung geprägten Regulationsstrategie in interpersonalen Beziehungen deutlich anders als ein sicher gebundener Führender. In empirischer Hinsicht kann Micha Popper (2002) dies anhand der Unterscheidung eines personalisierten und sozialisierten transformationalen Führungsstils veranschaulichen. So wird z.B. Narzissmus positiv mit vermeidender Bindungdes Führenden assoziiert, eine sichere Bindung mit sozial orientiertem Verhalten. Ist Ihr eigener Vorgesetzter bzw. Ihre eigene Vorgesetzte so den Menschen zuwendend aufgestellt?
Dann sollten Sie erkennen, dass er oder sie
- sich nicht an der eigenen Person, sondern am Team orientiert
- Teammitglieder ermuntert, sich selbst die Lösung von Problemen zuzutrauen
- garantiert, dass es im Team gerecht zugeht
- sich so verhält, dass seine/ihre Freunde ihm/ihr Respekt zollen.
Dies ist ein brauchbarer Kurztest, der dieser Studie von Micha Popper zugrunde lag. Die getestete Gegenfolie zielte auf eine Person ab, die eigennützig agierte und instrumentell (Nutzen-Kosten-Logik) gegenüber dem Team auftrat.
Die Bindungsorientierungen verdienen eine höhere Beachtung in der Führungspraxis
Führungskräfte geraten ins Abseits. Entweder als Person oder durch mindere Führungsleistung bis hin zum Führungsversagen, wenn sie ausgeprägte unsichere Bindungsstile aufweisen und dies nicht kaschieren können. Diese Überdeckung gelingt in Perfektion vor allem nur (subklinischen) Narzissten, die ihr ursprüngliches Minderwertigkeitsgefühl oder andere Alltagspathologien in ein grandioses Selbst transformieren konnten. Sie können dann für ihre Anhängerschar, zu denen auch eigene Vorgesetzte zählen, den Anschein erwecken, Top-Leistung aufgrund eigener Kraft zu erzielen und noch mehr Potenzial entwickeln zu können. Diese Kompensation ist allerdings nur die Ausnahme bei den Bindungsängstlichen.
Sicher, die Bedeutung der Bindungsorientierungen für Misserfolg in der Führung ist nicht genau zu beziffern, dazu liegen noch zu wenige Studien vor. Die Bedeutung ist nach theoretischer Analyse jedoch potenziell so hoch, um sich dem verstärkt zu widmen. Eine Folge: Die Bindungsorientierung sollte im Rahmen der Personalauswahl diagnostisch bestimmt werden. Dann sollte auch nicht vergessen werden, dass viele Personen gegen ihren eigenen Willen in eine Führungsverantwortung gebracht werden, die eine Führungsfunktion eigentlich nie einnehmen wollten, aber meinten, sich nicht verweigern zu können. Hierunter dürften sich, so unsere These, viele mit einer unsicheren Bindungsorientierung befinden.
Fairerweise ist abschließend zu betonen, dass die Bindungsqualität bei weitem nie die einzige Ursache für Erfolg und Misserfolg in der Führung ist, so etwas gibt es überhaupt nicht. Beispielsweise spielt auch die Bindungsorientierung der Mitarbeitenden dabei eine Rolle. Autonom denkende und handelnde Mitarbeiter, die das gerne und psychisch auf fester Grundlage tun, verkraften vieles, auch eine schwache oder sagen wir nicht optimal aufgestellte Führungskraft, und die Teamleistung stimmt trotzdem. Aber diese Voraussetzung ist eben auch nicht immer erfüllt.
Eine wichtige Konsequenz des Gesagten ist, der Bindungsorientierung im Rahmen der Führungskräfteentwicklung einen Platz einzuräumen. Bislang geschieht das fast nie. Vielleicht regen Sie es einfach mal an?